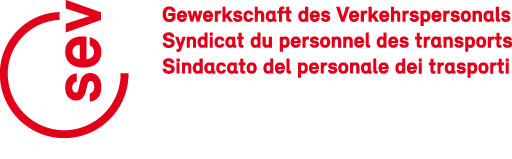Herausforderungen durch Coronavirus: Unsere inneren Ressourcen

Lorenzo Pezzoli ist Psychologe, Psychotherapeut, Dozent an der Fachhochschule der italienischen Schweiz SUPSI, Forscher und Mitglied der vom Kanton Tessin eingesetzten Expertengruppe, die Antworten finden soll auf die durch den Coronavirus entstehenden Ängste und Unsicherheiten. Er beleuchtet einige Aspekte dieser Krise, die unser Leben derzeit erschüttert, auch bei der Arbeit.
Professor Pezzoli, durch diese Pandemie sind unsere Gewohnheiten tief erschüttert worden. Wir alle werden von Gefühlen und Emotionen überwältigt, die oft schwer zu fassen sind. Wie finden wir in uns selbst die Ressourcen, um uns in dieser neuen Situation von Angst, Furcht, Wut und Unglauben zu bewegen?
Betrachten wir doch nur einige Aspekte dieser Pandemie: die unvorhergesehene Dimension des Ereignisses, die Bedrohung für das Leben (das eigene und das der geliebten Menschen), für den Alltag oder für die Grenzen, die in unserer Mobilität kaum noch wahrgenommen wurden. Aber auch für die bisher als «einem zustehend» betrachtete Freiheit und Selbstbestimmung, die plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Dazu kommt – wenn nicht gar an erster Stelle – die Beziehung zu anderen, die nichts Selbstverständliches mehr hat. Einerseits werden Beziehungen durch Trennung und Abstandhalten belastet, andererseits werden sie wegen der durch das Zuhausebleiben extremen Nähe als potenzielle Bedrohung wahrgenommen. Das sind nur einige der kritischen Situationen, die wir gerade erleben. Situationen, die Emotionen der unterschiedlichsten Art auslösen, aber auch notwendige Veränderungen der eigenen Sicht auf die Wirklichkeit und die Dinge des Lebens anregen können. Und doch gibt es nicht nur diese Aspekte. Manchmal werden wir, wie im Theater, von einer Art Spotlight-Effekt beeinflusst: Wir sehen nur das, was im Licht ist, d.h. worauf unsere Aufmerksamkeit durch den Scheinwerfer gelenkt wird oder worauf die – bewusste oder unbewusste – Überdosis gewisser Informationen uns hinweist. Wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was uns Angst macht, verlieren wir die anderen Dinge aus den Augen, die auch auf der Bühne des Lebens zu finden sind. Nur weil sie nicht hervorgehoben werden, sehen oder berücksichtigen wir sie nicht. Sie zu erkennen dient nicht dazu, uns abzulenken oder uns vorzumachen, dass das Unbehagen, die Schwierigkeiten nicht da sind. Wir sind nicht naiv. Indem wir auch die positiven, nützlichen und schönen Dinge betrachten, die uns das Leben eben auch bietet, gelingt es uns zu erkennen, dass nicht alles schlecht oder verloren ist. Selbst in kritischen Situationen finden sich unerwartete Reichtümer und Möglichkeiten. Ein solcher Perspektivenwechsel nimmt uns zwar nicht den Schmerz, aber er hilft uns, ihn auszuhalten. Ich erinnere mich gerne an einen Satz des Schriftstellers J. R. Tolkien, der bemerkte, dass die Welt «in der Tat voller Gefahren ist und es viele dunkle Orte gibt; aber man findet auch schöne Dinge, und obwohl die Liebe überall mit Schmerz verbunden ist, wird sie immer stärker.»
Auch Personen, die gesund sind und arbeiten, und oft auch Aufgaben von Kolleginnen und Kollegen übernehmen müssen, stehen unter erheblicher psychischer Belastung. Wie sollen sie mit der Situation umgehen?
Dem, was man tut, einen Sinn zu geben, ist ein Prozess, der nicht von einer gegebenen Situation ablenkt, sondern der die Person – jeden von uns – in Bezug auf diese Situation neu positioniert. Die persönliche Sichtweise macht den Unterschied, wie man einer Sache begegnet und sie erlebt. Der eigenen Arbeit, den eigenen Erwartungen und Bemühungen einen Sinn zu geben, ihren Wert über die unmittelbare Befriedigung hinaus zu verstehen, hilft einem dabei, vorwärts zu kommen. Es ermöglicht, auch etwas anderes zu erleben als nur die psychologische Belastung, die sie mit sich bringt; zu entdecken, dass eine Aufgabe zwar grosse Anstrengung und viele Schwierigkeiten beinhaltet, aber auch Möglichkeiten bietet, daran zu wachsen. Mir kommen da manche Eltern in den Sinn, die Opfer erbringen, ohne von ihren Kindern dafür Dankbarkeit zu bekommen, sondern womöglich gar unangenehme Reaktionen. Die Stärke, die sie daraus ziehen, liegt nicht in einer unmittelbaren Befriedigung, sondern in der Bedeutung, die sie ihren Entscheidungen und ihrem Verhalten geben. Es ist der Sinn und Wert, den wir den Dingen geben, die es uns ermöglichen, die damit verbundenen Härten auszuhalten und nicht aufzugeben.
Telearbeit ist schlagartig zu einer weit verbreiteten Realität geworden. Wer so arbeitet, muss Berufliches und Privates unter einen Hut bringen. Oft ist es nicht einfach, klare Grenzen zu ziehen. Wie können die Fallen dieser Arbeitsweise vermieden werden?
Das Setzen von – nicht nur räumlichen – Grenzen hilft der Orientierung (oder Neuorientierung) in einer radikal veränderten Realität. Wir sind wie Kartografen, die unsere Welt neu vermessen müssen: relational, räumlich, zeitlich. Der ersatzlose Verlust der gewohnten Grenzen kann zu Verwirrung und Desorientierung führen. Die Tagesstruktur muss neu definiert, Aktivitäten müssen innerhalb des Tages verlagert werden. So neu gesetzte Grenzen tragen dazu bei, uns vor Störungen zu schützen, die uns zu sehr beunruhigen. Dasselbe gilt für Emotionen: Grenzen setzen hilft. Konkret heisst das: Die Tagesroutine muss den neuen Umständen angepasst, manchmal auch ein wenig ritualisiert werden. Manche Gewohnheiten werden beibehalten, etwa die morgendliche Dusche und das Ankleiden. Daneben braucht es aber auch Pausen, die wir dazu nutzen, etwas für uns selbst zu tun, das wir gerne machen.
Es gibt auch Leute, die plötzlich allein und deshalb isoliert arbeiten. Welche Risiken kann diese plötzliche Einsamkeit mit sich bringen? Und was sind die Lösungen?
Die Isolation birgt die Gefahr, dass die Selbstbezogenheit Überhand nimmt. Mit dem fehlenden Gegenüber fallen sowohl Konfrontationen als auch das Gemeinschaftsgefühl weg. Es ist hilfreich, ein solches aufzubauen mithilfe der Beziehungen, die einem in der aktuellen Situation noch bleiben. Was wir durchmachen, ist eine globale Krise, eine Krise der Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich betrifft die Pandemie nicht eine Region, einen Staat oder ein Land, sondern die ganze Welt. Es ist eine Krise der gesamten Menschheit, vielleicht die tiefste Krise, die alle Menschen gleichzeitig betrifft. In diesem Zusammenhang umfasst die Isolation zwei Dimensionen. Die erste ist die Selbstbezogenheit, die ich eingangs erwähnt habe. Wenn wir in diese Dimension fallen, wird sich unser Handeln ausschliesslich nach unseren eigenen individuellen Bedürfnissen richten, mit allen negativen Auswirkungen auf andere. Man denke hier etwa an die Hamsterkäufe, die es anderen Menschen verunmöglichen, notwendige Güter des täglichen Lebens zu kaufen, nur weil die, die zuerst da waren, nur an sich selbst dachten. Die zweite Dimension besteht darin, dass die Isolation verhindert, von Solidarität und Austausch zu profitieren. Dies sind aber wesentliche Faktoren für das eigene psychische Wohlbefinden. Das Gefühl der Nähe – auch der physischen – wirkt sich positiv auf die eigene Widerstands- und Anpassungskraft aus. Ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln – mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und soweit es innerhalb der Normen möglich ist – ist zwar nicht die Lösung, aber ein Instrument gegen die negativen Auswirkungen der Isolation.
Das Verkehrspersonal leistet einen öffentlichen Dienst und tut dies auch bei der aktuellen gesundheitlichen Gefährdung mit einer erheblichen psychischen Belastung. Welchen Rat können Sie geben, um mit dieser neuen Situation umzugehen?
Wir sprechen oft von Menschen, die an der Front arbeiten. Dabei denken wir an die Mitarbeitenden des Gesundheitswesens, die gegen die Folgen von Covid-19 kämpfen und denen wir unseren Dank und unser Lob aussprechen. Aber die «Fronten», wenn wir diesen Kriegsbegriff verwenden wollen, sind zahlreich: Man denke nur an die Sozialarbeiter/-innen, die in Behinderteneinrichtungen arbeiten, an die Kassierer/-innen, die die Ladenöffnungszeiten garantieren usw. Zu all diesen Leuten an der Front gehört auch das Verkehrspersonal, das trotz den Widrigkeiten einen wertvollen Dienst aufrechterhält. Sich bewusst sein, dass man für die Gemeinschaft wichtig ist – um auf dieses Konzept zurückzukommen – nimmt einem zwar nicht die Angst, aber es gibt dem eigenen Tun einen Sinn und einen Wert. Sich auf das Hier und Jetzt und auf die für die eigene Sicherheit notwendige Sorgfalt und Vorsicht zu konzentrieren, kann helfen, das was man tut mit grösserem Bewusstsein zu tun. Eine solche Haltung ist bereits ein erster Schritt, um mit der schwierigen Situation zurecht zu kommen. Mut entsteht nicht aus einer oberflächlichen Verleugnung der Angst, sondern aus einem tiefen Bewusstsein für den Wert und den Sinn des Handelns.
Françoise Gehring/Übersetzung: Jörg Matter