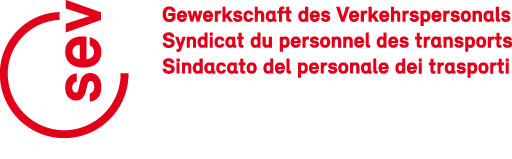Die Basler Professorin Elisabeth Zemp Stutz ist Spezialistin fürs Thema Geschlecht und Gesundheit
«Es braucht bestimmte Umgangsregeln»
Elisabeth Zemp Stutz widmet sich der Frage, wie das Geschlecht mit der Gesundheit zusammenhängt, unter anderem in der Arbeitswelt. Sie ist dieses Jahr Hauptreferentin am SEV-Bildungstag der Frauenkommission.

kontakt.sev: Beginnen wir bei Adam und Eva: Was ist der Unterschied zwischen Mann und Frau?
Elisabeth Zemp Stutz: Bei Adam und Eva lag der Unterschied in der Verführung…
Das ist also schon das erste Rollenbild: Die Frau als Verführende?
Tatsächlich ist schon dies eine Geschlechter-Zuordnung, die Handlung, die zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hat, wird Eva zugeschrieben. Aber zur Frage der Unterschiede: Es gibt diese auf verschiedenen Ebenen. Zum einen in der Genetik und der Biologie, zum andern bei der Körperausstattung und bei gewissen Funktionsweisen des Körpers, so beim Stoffwechsel oder bei hormonellen Funktionsweisen. Es gibt aber auch viele Unterschiede, die ihren Ursprung im gesellschaftlich-kulturellen Bereich haben, wie Wahrnehmungen, Verhalten oder auch die Berufswahl. Oft allerdings sind beide Bereiche miteinander verknüpft und nicht klar voneinander zu trennen.
Werden zurzeit die Unterschiede zwischen Männern und Frauen kleiner, gerade auch durch den Einfluss politischer Massnahmen?
Politische Massnahmen zielen darauf ab, eine Gleichstellung von Männern und Frauen zu erzielent. Im Gesundheitsbereich sind die Möglichkeiten der «Gleichmachung» beschränkter, so lässt sich das Kinderkriegen nicht gleichmässig auf Männer und Frauen verteilen … Aber die Gesundheits-Chancen sollten gleich sein, und darauf kann man auch mit politischen Massnahmen einwirken.
Wo gibt es etwas zu tun?
Der bekannteste Unterschied liegt bei der ungleichen Lebensdauer. Die Lebenserwartung ist im letzten Jahrhundert von 50 auf 80 Jahre angestiegen, bei Frauen in den westlichen Ländern ausgeprägter als bei Männern: In den 90er Jahren betrug der Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Schweiz rund sieben Jahre, die Männer haben also sieben Jahre weniger lang gelebt. Das hat sich nun wieder vermindert; seit 2012 sind es noch rund vier Jahre Unterschied. Dies ist durch eine Verbesserung bei den Männern zustande gekommen, etwa beim Rückgang der Suizide und der Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Dies sind auch die Bereiche, wo sich die wichtigsten Unterschiede bei der vorzeitigen Sterblichkeit abbauen lassen. In andern Bereichen ist dies schwieriger, so etwa im reproduktiven Bereich: ungewollte Schwangerschaften, Probleme im Zusammenhang mit der Menstruation, gynäkologische Krebserkrankun- gen spielen schon im Leben jüngerer Frauen eine wesentliche Rolle. Analoge geschlechtsspezifische Probleme treten bei den Männern erst später auf, etwa Prostatakrebs.
Wo drängen sich Massnahmen auf aus einer allgemeinen gesundheitlichen Sicht?
Viele dieser Erkrankungen hängen mit der Lebensweise zusammen und entstehen über lange Zeiträume, sowohl bezüglich der Risiken als auch des Schutzes. Da gibt es ein paar Klassiker: körperlich aktiv sein und gesund essen sind auf der positiven Seite, rauchen und Übergewicht auf der negativen Seite …

Wo gilt es anzusetzen?
Man sollte möglichst gezielt die jeweiligen Lebenssituationen einbeziehen und Motive aufnehmen, die stark beschäftigen. Diese unterscheiden sich oft bei Frauen und Männern. In der Rauchprävention etwa gibt es Projekte, die bei jungen Frauen damit arbeiten, dass Rauchen der Haut schadet und die Wichtigkeit des Äussern aufnehmen. Oder in neueren Rauchpräventionsprojekten der Lungenliga, die sich gezielt an junge Männer richten, die eine Berufslehre absolvieren. Hier beinhaltet eine der Botschaften, dass die Kleider eines «richtigen Mannes» nicht nach Zigaretten riechen sollen sondern nach Testosteron (wie auch immer das riecht …).
Soll man das alles überhaupt tun und die Lebenserwartung weiter steigern?
Sie fragen nach dem Gewinn! Was befürchten Sie?
Ich sage jeweils: Lasst mir den schönen Herztod, damit ich nicht 20 Jahre später an Krebs zugrunde gehe …
Der «schöne Herztod» ist ein unglaublicher Nimbus! Tatsächlich ist es viel häufiger, dass einen Herzschwäche während vieler Jahre begleitet. Zur Frage, ob man mehr Lebensjahre anstreben soll: Wir haben – gerade in den letzten 50 Jahren – nicht nur mehr Lebensjahre gewonnen, sondern mehr Lebensjahre bei relativ guter Gesundheit. Die Zeit, in der Leute krank sind und leiden, hat sich massiv komprimiert auf eine eigentlich kurze Lebensspanne. Die Bemühungen der Prävention bringen also nicht nur ein Mehr an Lebensjahren sondern auch an Lebensqualität.
Sprechen wir über Arbeitsumfelder. Der öffentliche Verkehr ist stark männlich dominiert. Gilt es deshalb besonders auf die Frauen zu achten?
Es gibt allenfalls Schutzbestimmungen, die besonders zu beachten sind, wenn Frauen in männertypische Berufe einsteigen, im Bereich der Fortpflanzung, aber auch bei den körperlichen Belastungen. Zudem gibt es im Alltag, in der Arbeitsgestaltung und im Umgang miteinander einiges zu beachten. Man weiss zum Beispiel aus Suchtinstitutionen, dass die Anliegen der Frauen ungenügend beachtet werden, solange ihr Anteil weniger als 20 bis 30 Prozent ausmacht. Vielleicht braucht es also bestimmte Umgangsregeln.

Im öffentlichen Verkehr ist sicher die Lokführerin der typische Fall. Das war früher zum Teil schwere körperliche Arbeit, heute aber nicht mehr. Trotzdem ist der Frauenanteil noch sehr klein.
Die körperliche Belastung dürfte, wie Sie sagen, heute kaum mehr ein Ausschluss-Kriterium sein, es werden inzwischen Kenntnisse und Fähigkeiten gefordert, die Frauen auch mitbringen können. Es gilt wohl eher, die Entwicklung zuzulassen, dass Lokomotiven fahren auch etwas für Frauen sein kann und dies bei Berufsdarstellungen und in Inseraten auszudrücken.
Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Medikamente bei Frauen und Männern nicht gleich wirken. Ich könnte mir vorstellen, dass eben auch der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nicht gleich ist für Männer und Frauen, auch wenn es derselbe Beruf ist.
Bei Medikamenten ist es insofern anders, weil es darum geht, dass Substanzen im Körper etwas bewirken sollen; und bei diesen Prozessen gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bei der Arbeit ist es gerade anders: Da geht es darum, Arbeitende vor schädlichen Substanzen oder andern schädlichen Einwirkungen zu schützen, Männer wie Frauen. Wichtig ist die Frage, ob eine Frau besonders geschützt werden müsste, sei es, weil sie schwanger ist oder ob die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt werden könnte. Da braucht es besondere Schutzbestimmungen.
Wem nützt Ihr Tätigkeitsgebiet, Gesundheitsvorsorge, am meisten: dem Einzelnen, der Gesellschaft oder der Wirtschaft?
Idealerweise allen!
Und tatsächlich?
(zögert) Wir arbeiten in der öffentlichen Gesundheit, «Public Health». Wir versuchen über Programme, über die Gesetzgebung, über Rahmenbedingungen zu wirken. Insofern ist es weniger die einzelne Person, sondern die Bevölkerung, auf die unsere Aktivitäten ausgerichtet sind. Insofern profitiert die Gesellschaft. Aber natürlich betrifft dies ja dann auch einzelne. Wir wissen auch, dass reichere Länder mehr in die Gesundheitssysteme investieren als viele Länder des Südens, und dass sich dies drastisch auch auf den Einzelnen auswirkt, beispielsweise in x-fach höheren Müttersterblichkeitsraten.
Ihr Tätigkeitsfeld ist äusserst breit: vom Stillen in den ersten Lebensmonaten bis hin zur Medikation bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wo liegt Ihre Vorliebe?
Mein Leitinteresse ist die Frage, wie sich das Geschlecht auf die Gesundheit auswirkt, und das lässt sich durch alle Lebensalter und in vielen gesundheitlichen Bereichen untersuchen.
Wo muss man am dringendsten etwas machen?
In der Schweiz?
Überhaupt – Sie haben ja übers Stillen in Ländern des Südens geforscht, das ist bei uns sicher etwas anderes …
Die Vereinbarkeit von Stillen und Arbeit ist auch hier ein sehr aktuelles Thema! Mehr Frauen sind heutzutage berufstätig als früher, sie arbeiten in höheren Pensen und steigen früher nach einer Geburt wieder in den Beruf ein. Die bezahlte Mutterschaftszeit beträgt 14 Wochen und Frauen dürfen nicht ohne ihr Einverständnis vor 16 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten, aber da ist das Stillen bei vielen längst nicht abgeschlossen: in der Schweiz betrug im Jahr 2014 die mittlere Stilldauer 31 Wochen; die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie empfiehlt 4 bis 6 Monate ausschliessliches Stillen. Die Frauen müssen informiert sein, dass sie an der Arbeit und in der bezahlten Arbeitszeit stillen dürfen. Lediglich 10 Prozent der wieder erwerbstätigen Mütter sagen, sie wären von ihren Arbeitgebern über ihre Rechte informiert worden und nur gerade ein Drittel hatte am Arbeitsplatz einen Stillraum zur Verfügung.
Sie sind die Hauptreferentin am Bildungstag der SEV-Frauen. Was ist dort Ihre Hauptbotschaft?
Ganz generell will ich die Frauen ermutigen. Sie sollen sich zutrauen, auch in Tätigkeiten zu arbeiten, wo sie in der Minderheit sind, sich da aber einbringen, sich vielleicht auch organisieren, um Anpassungen und Verbesserungen zu erreichen. Zentrale Themen sind zudem die Sorge für die Gesundheit im mittleren Lebensalter, mit besonderem Hinweis auf Herzerkrankungen und Krebsvorsorge, und dass diese sich auch später noch lohnt.
Interview: Peter Moor
Bio
Alter: 60
Familie: verheiratet, eine Tochter
Werdegang: Medizinstudium, FMH in Prävention im Gesundheitswesen, ein Jahr Spezialisierung in Boston; Professur an der medizinischen Fakultät der Universität Basel. Seit der Dissertation besonderes Interesse für Frau und Gesundheit, später breiter für Geschlecht und Gesundheit, was nun der Arbeitsschwerpunkt ist. Seit 2009 am Schweiz. Tropen- und Public-Health-Institut in Basel, Leiterin der Arbeitsgruppe zu Geschlecht und Gesundheit.
Freizeit: Gerne im Freien, lesen, Ausstellungen besuchen, Musik hören