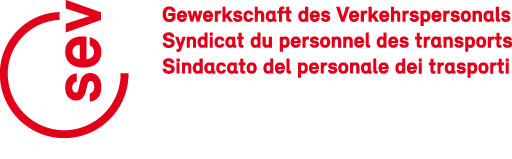Delegiertenversammlung SGB zur EU
Service public und Löhne schützen!

Nur wenn die Löhne und der Service public gesichert sind, können die Gewerkschaften einem Abkommen der Schweiz mit der EU zustimmen. Darin sind sich die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) einig. An der ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 31. Januar 2025 in Bern haben sie einer entsprechenden Resolution zugestimmt.
«Wenn ich in Deutschland eine Fahrkarte für den Zug kaufe, ist das, als würde ich ein Lotterieticket kaufen», sagt SEV-Präsident Matthias Hartwich vor den Delegierten des SGB. «Man weiss nicht, wo man plötzlich umsteigen muss, wann oder ob man überhaupt je am Ziel ankommt. Das sind die Folgen von Liberalisierung und Privatisierung der Schiene. Und solche Verhältnisse wollen wir hier in der Schweiz nicht.» Der SEV und alle anderen Gewerkschaften unterstützen zwar grundsätzlich die Annäherung an Europa, doch nicht um jeden Preis. VPT-Präsident Gilbert D’Alessandro bringt es auf den Punkt: «Wir sind überzeugte Europäerinnen und Europäer. Aber wir mögen die EU-Kommission nicht, die sich zur Totengräberin der sozialen Errungenschaften gemacht hat.» Der Verlust sozialer Sicherheit ist mitunter ein Grund dafür, dass rechtsextreme Kräfte in ganz Europa Zuwachs haben.
Schweizer Recht auf Schweizer Schiene
Bei der möglichen Öffnung des internationalen Personenfernverkehrs auf der Schiene verlangt der SGB, dass die ausgehandelten Absicherungen vollumfänglich autonom umsetzbar sind. Schweizer Lohn- und Arbeitsbedingungen müssen jederzeit sichergestellt sein. Das Kooperationsmodell muss weiter zulässig, die Tarifintegration gewährleistet und die Trassenvergabe unter Schweizer Hoheit garantiert sein. Es muss der Grundsatz gelten: Schweizer Recht auf Schweizer Schiene. «Als Servicepublic-Gewerkschaft können wir keine Lösung mittragen, welche unser funktionierendes öV-System gefährdet, die Sicherheit verschlechtert und zu einer schlechteren Umweltbilanz führt», sagt AS-Präsident Peter Käppler. «Uns macht auch die Situation des Güterverkehrs Sorgen. Die von der EU-Kommission geforderten Privatisierungen staatlicher Betriebe führen zur Verlagerung von der Schiene auf die Strasse.» Rund ein Dutzend Rednerinnen und Redner machen deutlich, auch in anderen Branchen herrscht grosse Besorgnis.
Hochproblematisch ist beispielsweise die «EU-Spesenregel». Gemäss dieser müssen ausländische Firmen in der Schweiz die Übernachtungs- und Verpflegungskosten zu den Ansätzen in ihrem Herkunftsland zahlen («polnische Spesen in der Schweiz»). Dabei geht es nicht nur um viel Geld, das den Arbeitnehmenden fehlt. Sondern es geht auch um menschenwürdige Unterkünfte und um Arbeitssicherheit. Wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter zu wenig Geld haben, werden sie in Lieferwagen oder auf Baustellen schlafen und essen müssen.
Ebenfalls besorgniserregend ist das neu verhandelte Stromabkommen. Damit soll die Schweiz zwar vollen Zugang zum europäischen Strombinnenmarkt erhalten. Im Gegenzug muss der Schweizer Strommarkt komplett geöffnet werden. Anstelle der heutigen Grundversorgung für Haushalte und kleine Unternehmen bliebe nur ein dysfunktionales «Wahlmodell» übrig. Der integrale Service public im Strombereich würde damit empfindlich geschwächt. Und mit ihm auch die langfristige Preisstabilität für Kleinkundinnen und -kunden sowie die Planungssicherheit für die Verteilnetzbetreiber.

Konkrete Forderungen
Der Bundesrat hat die Verhandlungen mit der EU-Kommission am 20. Dezember 2024 als abgeschlossen erklärt. Die Verhandlungsziele seien erreicht. Die Details sind allerdings bis jetzt unbekannt. Immerhin hat sich der Bund bereit erklärt, mit den Gewerkschaften und den Arbeitgebern nun innenpolitische Verhandlungen zu führen.
Mit konkreten Forderungen gehen die Gewerkschaften nun in diese Verhandlungen. Neben den Forderungen des SEV zum internationalen Schienenpersonenverkehr wurden folgende Punkte definiert: eine Bauherrenhaftung und Verantwortung von Auftraggebern für Verstösse ihrer Subunternehmen, verkürzte Bearbeitungszeiten der Kantone, Nachverhandlung der Spesenregelung, mehr allgemeinverbindliche Gesamtarbeitsverträge, ein besserer Kündigungsschutz für Berufstätige, die sich für gute Arbeitsbedingungen und für die Arbeitssicherheit einsetzen, Besserstellung von Temporärbeschäftigten und keine Liberalisierung des Strommarktes.
Unterstützt werden die Schweizer Gewerkschaften von ihren europäischen Schwestergewerkschaften. Esther Lynch, Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) macht dies in ihrer Videobotschaft deutlich: «Der EGB steht fest an der Seite der Schweizer Gewerkschaften, wenn es um die Verteidigung der Rechte der Arbeitnehmenden und die Aufrechterhaltung starker öffentlicher Dienstleistungen geht.»
In der Resolution, die von den Delegierten am Schluss der Versammlung verabschiedet wird, machen sie deutlich: Jetzt muss hart verhandelt werden. Werden Löhne und Service public nicht geschützt, dürfte es keine Zustimmung zum Abkommen der Schweiz mit der EU geben.
Michael Spahr/SGB