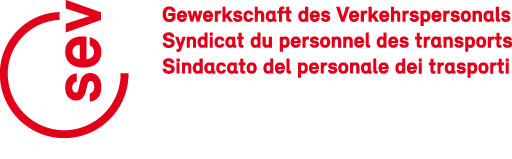interview mit Martin Hablützel, Anwalt
«Man will die Asbesttragödie nicht sehen»

Der Zürcher Anwalt Martin Hablützel vertritt regelmässig Asbestopfer. Wir sprachen mit ihm angesichts der Aktualität des Themas bei der SBB.
Die Schweiz tut sich mit dem Thema Asbest unglaublich schwer. Woran liegt das?
Martin Hablützel: Die Schweiz hat erstens eine Reduit-Mentalität. Man zieht sich bei Krisen sehr lange zurück und vertraut darauf, dass sich das Problem von alleine löst. Beim Asbest brauchte es den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der entschied, eine Sache könne nicht verjährt sein, bevor jemand überhaupt von seiner Krankheit Kenntnis hat. Ein zweiter Punkt ist der Arbeitsfrieden. Man schützt sehr stark die Unternehmungen und die Unternehmer. Man will der Verantwortung nicht auf den Grund gehen.
Weshalb sind Verkehrsunternehmen wie SBB und BLS so stark betroffen? Eigentlich ist Asbest ja ein Baustoff.
Wegen der möglichen Hitzeentwicklung hat man in den Bahnen unter anderem in Zwischenwänden und Elektrokästen Asbest verwendet. Die grössten Probleme entstanden dann bei Revisionen, also beim Einbau neuer Elektrik oder neuer Lüftungsschächte. Dazu kommt, dass alle Wagen am selben Ort saniert wurden, in Werkstätten wie Bönigen der BLS oder Bellinzona der SBB, über Jahrzehnte hinweg.

Nein, es ist umgekehrt. Wir mussten ja zuerst wissen, was passiert ist, denn in der Regel braucht es auch für eine Haftpflichtforderung ein Fehlverhalten. Im Strafrecht hat man den Vorteil, dass der Staat von sich aus Abklärungen tätigen muss. Das war im Glarnerland so mit einem Strafverfahren gegen Eternit, in Baden gegen ABB und in Thun gegen die BLS. Jetzt prüft man in Bellinzona bei der SBB, ob gegen Arbeitnehmerschutzbestimmungen verstossen wurde.
Wie sind Sie vorgegangen bis zum ersten Erfolg?
Das Strafrecht klärt, ob jemandem im Umgang mit Asbest ein strafrechtliches Verhalten nachgewiesen werden kann. Das Zivilrecht beantwortet die Frage, ob jemand aufgrund seiner Erkrankung einen finanziellen Anspruch hat. Weiter gibt es die Opferhilfe, die zum Zug kommt, wenn nicht klar ist, wer der Täter ist oder der Täter kein Geld hat. Dann gibt es die Suva: Wenn jemand eine Berufserkrankung erleidet, hat er ein Taggeld zugut, und Heilungskosten sind zu übernehmen; wenn es nicht bessert, entsteht ein Rentenanspruch. Schliesslich gibt es die so genannten Integritätsentschädigungen. Das ist eine Art Schmerzensgeld der Suva. Da haben wir die ersten Erfolge erzielt.
Worum ging es dabei?
Diese Integritätsentschädigung wird bezahlt, wenn die Lungenfunktion massiv eingeschränkt ist. Anfangs hat sich die Suva auf den Standpunkt gestellt, dass solche Entschädigungen erst nach zwei Jahren ausgerichtet würden, weil der Gesundheitszustand noch nicht stabil sei. Das ist eine zynische Begründung, denn etwa 97 Prozent der Asbestopfer sind innerhalb der zwei Jahre gestorben. Schliesslich haben wir eine Vereinbarung getroffen. Das brachte den Asbestopfern immerhin die Genugtuung, dass noch zu Lebzeiten Gelder geflossen sind. Seit 2017 wird nun beim Zeitpunkt der Diagnose Pleuramesotheliom die gesamte Integritätsentschädigung ausbezahlt, das sind heute ca. 119000 Franken.
2017 kam dann gleichzeitig auch die Stiftung.
Ja, die Stiftung sollte eine Antwort sein auf den Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Man wollte eine pragmatische Lösung mit einem Entschädigungsfonds. Er ist in erster Linie für jene Betroffenen gedacht, die ein Mesotheliom haben, aber keine Leistungen der Suva bekommen, weil die Krankheit nicht auf eine berufliche Asbestexposition zurückgeführt werden konnte. Aber die Leute sterben ja, und sie sterben schnell, und darum sind es nun häufig die Angehörigen, die etwas bekommen.
Sind mit dem Fonds auch die Klagen erledigt?
Nein, aber der Entschädigungsfonds wurde schon zur Hauptsache gemacht, damit die Industrie von den Klagen verschont wird. Und zwar nicht nur die Asbestindustrie, sondern dahinter steht auch noch die Versicherungsindustrie. Der Fonds ist grundsätzlich eine gute Sache. Der Nachteil ist aber, dass man die Asbesttragödie nicht richtig aufarbeiten wird. Die Auseinandersetzung mit der Asbesttragödie würde wachsam machen für die Zukunft, etwa bei Fragen zur Nanotechnologie, zu Strahlenschäden oder sonst etwas.
Aber Sie verzichten nicht auf Prozesse?
Nein, aber man muss sehen: Ein solcher Prozess dauert in der Schweiz erstinstanzlich mindestens fünf Jahre. Die Gegenseite ist in der Regel prominent vertreten durch grosse Anwaltskanzleien auf dem Platz Zürich. Ich habe im Glarner Verfahren vier Gegenparteien, unter anderem die SBB wegen dem angrenzenden Bahnhof als Umschlagplatz der Asbestsäcke. Jeder Anwalt dieser Gegenparteien schreibt praktisch ein Buch als Abwehrschrift, da wird nicht gespart!
Das Bösartige ist doch: Man hat 30, 40 Jahre Angst, und dann ist man so schnell tot. Man vermutet, dass man Asbest eingeatmet hat und wartet darauf, dass die Krankheit ausbricht, aber vorher kann man gar nichts machen.
Das ist ein grosses Problem. Aber insgesamt trifft es wenige Leute. Es gibt unzählige Arbeiter, die jahrelang in diesen Werken waren und nicht erkranken, andererseits habe ich ein Opfer, das gerade mal vier Wochen in einem Betrieb gearbeitet hat. Wer beruflich über Jahre damit konfrontiert wurde, kann nun über den Fonds eine psychologische Beratung beanspruchen und eine jährliche medizinische Abklärung über die Unfallversicherung machen lassen, aber es gibt keine Abgeltung. Anders in Frankreich: Wer in einem Betrieb gearbeitet hat, wo Asbest verarbeitet wurde oder vorgekommen ist, erhält eine Genugtuung ausbezahlt.
Nach wie vor ist Asbest in vielen Bauten und Fahrzeugen vorhanden. Auch die SBB wurde vor ein paar Jahren in Bellinzona überrascht. Kann das auch bei bester Vorsicht passieren?
Da haben gewisse Kontrollabläufe versagt. Das darf bei den Bahnen nicht passieren. Man weiss, wo die Risiken sind. Und man weiss auch, welche Massnahmen zu ergreifen sind, welche Vorsorgeuntersuchungen anzuordnen sind. Man muss ja nicht eine Hysterie entfachen, es soll keine Angstmacherei sein.
Peter Moor
Barbara Spalinger antwortet:
Was soll ich tun, wenn ich bei der Arbeit mit Asbest in Kontakt gekommen bin oder Zweifel habe, ob dies der Fall gewesen ist? Und was sind meine Rechte als Arbeitnehmer/in?
Zuerst mal ist es wichtig festzuhalten, dass die Besorgnis der Mitarbeitenden der Officine in Bellinzona völlig legitim ist. Sie haben gemerkt, dass die Suva einige von ihnen nicht mehr oder noch nie zur Teilnahme an ihrem Screening-Programm eingeladen hat, obwohl sie bei ihrer Berufstätigkeit mit Asbest in Kontakt gekommen waren. Über 50 Personen, die in den Officine arbeiten oder früher dort tätig waren, haben sich bei der Peko gemeldet, seit die Suva bisherigen Teilnehmenden am Programm brieflich mitgeteilt hat, dass sie künftig nur noch alle paar Jahre statt jährlich untersucht würden.
Die Verunsicherung beschränkt sich nicht nur auf die Officine. Auch Mitarbeitende anderer SBB-Werke haben uns kontaktiert, und wir beraten sie gerne, seien sie aktiv oder pensioniert. Der Gesundheitsschutz ist ein wichtiger Teil der gewerkschaftlichen Arbeit. Vor etwa zehn Jahren lancierte der SEV eine Infokampagne zum Asbest, der in der Schweiz seit 1990 verboten ist. Damals wie heute empfehlen wir allen Kolleg/innen, die beruflich mit Asbest zu tun gehabt haben, sich beim Arbeitgeber zu melden. Denn dieser ist verpflichtet, alle Mitarbeitenden, die mit Asbest in Kontakt gekommen sind, über ihre Rechte zu informieren und sie für das Screening-Programm anzumelden.
Wenn Arbeitgeber ihrer Pflicht ungenügend nachkommen, kann der SEV intervenieren.Und sein Berufsrechtsschutz-Team kann Mitglieder beraten und unterstützen.
Bei bestimmten Krankheiten, die durch Asbest ausgelöst werden, kann es 40 Jahre dauern, bis sie sichtbar werden. Deshalb ist zu erwarten, dass zwischen 2020 und 2030 eine neue Welle von Erkrankungen auftreten wird. Beim Verkehrspersonal besteht dieses Risiko vor allem bei Personen, die im technischen Service tätig waren. Für sie ist es wichtig, dass sie auf ihre Fragen Antworten erhalten.