«Fight for $15»
USA: Erfolgreiche Mindestlohnkampagne
In den USA erhöhen immer mehr Staaten die Mindestlöhne. In New York erhalten Fast-Food-Mitarbeiter seit 1. Januar 15 Dollar pro Stunde. Amazon zahlt das sogar landesweit. Was ist los im Kernland des Kapitalismus?

Es war ein Fall von «Du hast keine Chance, also nutze sie». Als im November 2012 rund hundert Beschäftigte von McDonald’s, KFC und Burger King in New York eine Schicht lang streikten, stiess ihre Forderung auf ungläubiges Staunen: ein Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde? Keine Chance, erklärten selbst wohlmeinende Beobachter. Schliesslich war der gesetzliche Niedrigstlohn in der Stadt, die nie schläft, damals mit 7,25 Dollar nicht einmal halb so hoch.
Sieben Jahre später hat die Bewegung «Fight for $15» ihr Ziel erreicht: Seit 1. Januar müssen die Fast-Food-Ketten der Stadt ihren Mitarbeitern mindestens 15 Dollar pro Stunde zahlen, und auch die rund 25000 Flughafenarbeiter profitieren von der Regelung.

New York ist bei Weitem nicht der einzige Ort, an dem der Staat den sogenannten Working Poor beigesprungen ist: 19 Bundesstaaten und 21 Städte haben zu Jahresbeginn die Mindestverdienstgrenze erhöht. In Amerika herrscht nun ein bunter Flickenteppich an Regeln. Denn die Vorgabe des US-Kongresses, der den Mindestlohn 2009 auf 7,25 Dollar festgelegt und seitdem nicht erhöht hat, darf von den Bundesstaaten zwar nicht unter-, aber doch überschritten werden. Und so müssen Unternehmer in Alabama ihrer Belegschaft weiterhin nur 7,25 Dollar zahlen, während es in South Dakota 9,10 Dollar und im Bundesstaat Washington 12 Dollar sind. Die dortige Stadt Seattle, Sitz von Amazon und Starbucks, schreibt sogar ein gesetzliches Minimum von 15 Dollar beziehungsweise 16 Dollar für grössere Unternehmen vor.



Den Durchbruch hat «Fight for $15» mit einer geschickten Kampagne geschafft, die lautstarken Graswurzel-Aktivismus mit umtriebiger politischer Lobbyarbeit kombiniert. Dahinter steht vor allem die Dienstleistungsgewerkschaft SEIU.
Volksabstimmungen als Abkürzung zum Ziel
Die Mindestlohnbewegung hat in den vergangenen Jahren einen Weg beschritten, der sich als Abkürzung zum Ziel erwies: Volksabstimmungen. «Vor 2010 waren Wählerinitiativen in erster Linie ein Instrument der Rechten, um konservative Themen durchzusetzen. Aber plötzlich ist die Linke aufgewacht», sagte Heidi Gay, Co-Präsidentin des Dienstleisters National Ballot Access, der «Washington Post».
Und es zeigte sich, dass auch im Kernland des Kapitalismus viele Bürger eine schützende Hand des Staats möchten. In zwölf Bundesstaaten stimmten die Wähler in den vergangenen Jahren dafür, die Mindestlöhne zu erhöhen. Zum Beispiel auch in Arkansas und Missouri, wo der Kandidat der eher markttreuen Republikaner, Donald Trump, bei der Präsidentschaftswahl 2016 solide gesiegt hatte. Auch bei den Zwischenwahlen vergangenes Jahr räumten die Konservativen in Arkansas ab. Einen Sieg aber fuhren die Demokraten am Wahltag immerhin ein: beim Votum über höhere Mindestlöhne. Der Bundesstaat wird nun den Lohn schrittweise bis auf 11 Dollar im Jahr 2021 anheben – es wird der höchste Mindestsatz aller Staaten sein, wenn man die Zahl in Relation zu Kaufkraft und Durchschnittsverdiensten setzt – Arkansas ist nämlich einer der ärmsten US-Staaten.
Dagegen klingen die 15 Dollar in New York besser, als sie für die Beschäftigten sind. So hat die 33-jährige Theresa Borkowski, Absolventin der American University, im «Wall Street Journal» exemplarisch geschildert, wofür sie das Einkommen ihrer regulären 48-Stunden-Woche mit zwei Jobs aufwendet: Für ihr WG-Zimmer in Brooklyn zahlt sie allein 1050 Dollar im Monat, mit 300 Dollar stottert sie ihren Studienkredit ab, 100 Dollar gibt sie für die U-Bahn zur Arbeit aus und 93 Dollar fürs Handy. Für Obst und Gemüse setzt sie 50 Dollar die Woche an. Nach Berechnung von Ökonomen der renommierten Hochschule MIT benötigt ein vollzeitbeschäftigter Erwachsener 16,14 Dollar pro Stunde, um im Bezirk Manhattan leben zu können. In der Hauptstadt Washington sind es sogar 17,11 Dollar, in Arkansas dagegen nur 10,38 Dollar.
Genauso wie in Deutschland ist auch in den USA unter Ökonomen umstritten, ob und ab welcher Höhe Mindestlöhne der Wirtschaft und den Beschäftigten selbst schaden oder nutzen. Jedenfalls ist der Zeitpunkt für «Fight for $15» so günstig wie lange nicht. Dank der boomenden Konjunktur übersteigt die Zahl der offenen Stellen derzeit die der Jobsuchenden.
Der Onlinegigant Amazon hat im vergangenen Herbst von sich aus einen Mindestlohn für seine US-Belegschaft von 15 Dollar verkündet. Die Discounterkette Target will bis 2020 nachziehen, während der grösste Einzelhändler Wal-Mart mit einem Einstiegslohn von 11 Dollar pro Stunde noch hinterherhinkt und deswegen ins Visier der Aktivisten geraten ist. «Die Wal-Mart-Mitarbeiter haben es satt, für Hungerlöhne zu arbeiten. Ich sage der Walton-Familie von Wal-Mart, tun Sie das Richtige und zahlen Sie Ihren Beschäftigten einen Lohn, von dem sie leben können», twitterte der linke Senator Bernie Sanders. Er will ein Gesetz durchbringen, das den Konzernen den Rückkauf eigener Aktien verbietet, wenn sie ihrem Personal nicht mindestens 15 Dollar pro Stunde zahlen.
So wie Sanders haben viele amerikanische Politiker gemerkt, dass sie mit dem Thema punkten können und ihre Bedenken über die makroökonomischen Folgen über Bord geworfen. Auch Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, steht bei ihren Wählern im Wort. 2017 hat sie versprochen, bei einer Machtübernahme ihrer Partei «in den ersten 100 Stunden» einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der den Mindestlohn in den USA von 7,25 auf 15 Dollar erhöht. Die Demokraten haben das entsprechende Gesetz mittlerweile eingebracht.
Ines Zöttl, Washington

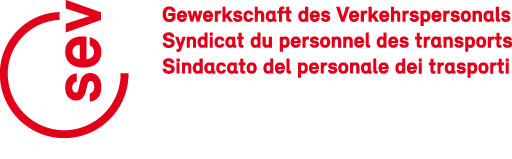



Kommentare
Gilbert ESCHER 31/01/2019 07:22:21
Triste de lire que le point fort de l'année sera une grève. De plus en plus je dois constater que la ligne SEV est alignée sur un modèle de confrontation plutôt que de négociation, politique copiée par des dirigeants SEV inspirés par des mouvements courants en France ou en Italie. Souvent, est c'est peut être une des raisons, les initiateurs de cette ligne d'actions dommageables, sont originaires de ces pays.