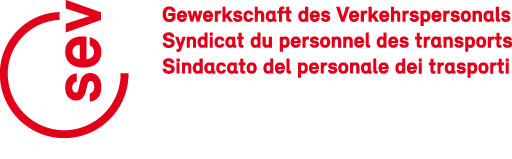Die (neoliberale) Lehre der Wirtschaftshochschulen wird der Realität nicht mehr gerecht, sagt Prof. Sergio Rossi
«Staat und Markt ergänzen sich»
An der Feier zum sechsten Jahrestag des Streiks im Industriewerk Bellinzona beeindruckte Wirtschafts- professor Sergio Rossi mit einer klarsichtigen Analyse der aktuellen Probleme unserer Wirtschaft und Gesellschaft. kontakt.sev liess sich von ihm gewisse Aussagen im Interview ausführlicher erklären.

kontakt.sev: Sergio Rossi, Sie lehren Makroökonomie. Womit beschäftigt sich diese Wissenschaft genau?
Sergio Rossi: Die Makroökonomie behandelt die gesamte Wirtschaft, mit all ihren Subjekten: Unternehmen, Banken, Familien und öffentlicher Sektor, die miteinander über verschiedene Märkte – nationale und internationale – in Wechselwirkung stehen. Einerseits untersucht sie die Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Kategorien von Subjekten, die viele wirtschaftliche Grössen beeinflussen, wie die Preise, die Löhne, die Inflation oder die Arbeitslosigkeit. Andererseits analysiert sie Wirtschaftspolitiken und deren Ziele: die Finanzpolitik der öffentlichen Hand und die Geldpolitik der Zentralbank. Beide sollten zu wirtschaftlicher und finanzieller Stabilität auf nationaler Ebene beitragen, indem sie die Schaffung von Stellen und die nachhaltige Entwicklung fördern.
Kurz, die ganze Welt dreht sich um Makroökonomie ...
Ja, und es gibt zwei Ansätze: jenen der Neoliberalen, die bei jeder Gelegenheit weniger Staat und mehr Markt fordern, und jenen der übrigen Makroökonomen wie mir, für die sich Staat und Markt vielmehr ergänzen. Die Geschichte hat gezeigt, dass eine staatliche Planwirtschaft nicht funktioniert. Heute können wir aber auch feststellen, welche Grenzen eine Wirtschaftsordnung hat, die nur auf freiem Markt basiert. Ich plädiere für eine «soziale Marktwirtschaft», in welcher der Staat die Mängel des Marktes behebt und in welcher der Markt die Aufgaben übernimmt, die der Staat nicht effizient erfüllen kann.
Heilbringend wäre also ein goldener Mittelweg?
Genau: ein Plansystem stimuliert nicht zu persönlicher Initiative, während der Liberalismus zu anderen Extremen führt, insbesondere zu einer immer ungleicheren Verteilung der Einkommen. Der Markt allein ist nicht imstande, alle Probleme zu lösen. Gerade die SBB ist ein Beispiel dafür: der Grund für ihre Entstehung war nicht staatlicher Monopolwille, sondern das Fehlen privater Akteure, die bereit gewesen wären, das nötige Kapital in die Bahn zu investieren. Also hat der Staat die Aufgabe übernommen, welche die Privatwirtschaft nicht erfüllte. Diese zeigt heute zwar ein gewisses Interesse am öffentlichen Verkehr, jedoch nur an den rentablen Bereichen. Die unrentablen aber überlässt sie gerne weiter dem Staat. Bei Privatisierungen spielt diese Marktlogik.
Heute scheint aber der Glaube vorzuherrschen, dass die Probleme nur durch die freie Initiative von Einzelpersonen gelöst werden können, während staatliche Eingriffe auf ein Minimum zu beschränken seien.
Das ist auch eine Frage der Rhetorik. Heute redet man viel über die Fehler des Staates oder Erscheinungen wie die Korruption, um zu belegen, dass der Liberalismus der einzig richtige Weg sei, obwohl bei diesem das persönliche Engagement allein auf einen maximalen Gewinn abzielt. Und wenn offensichtlich wird, dass der freie Markt nicht immer korrekt funktioniert, gibt man dem Staat die Schuld dafür, indem man ihm vorwirft, er habe den Markt nicht richtig reguliert.
Ist es möglich, diese Märkte zu regulieren?
Man muss berücksichtigen, wie gewisse Mechanismen funktionieren: Der Preis eines Gutes – zum Beispiel eines Autos – hängt von Nachfrage und Angebot ab. Wenn die Nachfrage steigt, tendiert auch der Preis des Autos nach oben, wenn dieses nicht in grösserer Zahl angeboten werden kann. Wenn der Autopreis steigt, tendiert aber auch die Nachfrage nach unten, was wiederum zu einer Preissenkung führt. Auf den Finanzmärkten spielt dieser Mechanismus nicht: Wenn der Preis einer Aktie steigt, zieht die Möglichkeit, damit Gewinn zu machen, viele Käufer an, was den Preis der Aktie zusätzlich steigen lässt. Diese Spirale führt mit der Zeit zu einer Blase. Wenn klar wird, dass der Preis der Aktie vom Wert des Unternehmens völlig losgelöst ist, platzt die Blase und kann das gesamte System beschädigen. Die Zentralbank könnte beschliessen, einzugreifen, wenn das Missverhältnis zwischen dem Wert des Unternehmens und dem Preis seiner Aktien eine vorgegebene Grenze übersteigt. Oder der Staat könnte eine Minimaldauer für den Besitz von Aktien vorschreiben, bei deren Unterschreitung eine Steuer fällig würde, wie dies der Ökonom James Tobin vorgeschlagen hat. Solche Eingriffe sind übrigens in andern Sektoren, wie dem Immobilienmarkt, bereits vorgesehen. Wir können nicht weiterhin glauben, dass sich der Markt selbst reguliert. Das gilt auch für den Arbeitsmarkt, der korrekt reguliert werden muss.
Das Schweizer Stimmvolk hat die Mindestlohn-Initiative aber klar abgelehnt …
Gewisse Regeln sind trotzdem nötig. Nestlé zum Beispiel hat für die Kader Lohnstufen definiert, die je nach dem Einsatzland und den dortigen Lebenskosten so angepasst werden, dass die Kaufkraft des Lohnes überall etwa dieselbe bleibt. In der Schweiz könnte man mit einem analogen Lohnsystem die Lebenskostenunterschiede zwischen den Regionen berücksichtigen.
Der Staat könnte aber auch eingreifen, indem er Faktoren wie die Raumplanung, die Förderung der Randregionen oder die Landschaftsgestaltung berücksichtigt und zum Beispiel Unternehmen differenziert besteuert als Anreiz dafür, dass sie sich ausserhalb der grossen Zentren niederlassen. Die Probleme, die sich daraus ergeben, dass die Personalkosten regional verschieden sind, müssen angebotsseitig gelöst werden, statt sie auf die Arbeitnehmenden abzuwälzen. Denn diese sind, unabhängig von ihren Qualifikationen, in ihrer Mobilität natürlicherweise eingeschränkt.
Aber ist es nicht gerade der Steuerwettbewerb, der den Druck auf die Strukturen und Arbeitnehmenden erhöht?
Das stimmt. In der Schweiz haben wir von einem System, das auf Zusammenarbeit und Solidarität zwischen den Kantonen setzte, zu einem System gewechselt, das die Konkurrenz fördert. In diesem können nur jene Kantone, die schon über eine kritische Masse von Unternehmen verfügen, ihre Unternehmenssteuern senken, um weitere Unternehmen anzuziehen. So richtet die Steuerkonkurrenz etlichen Schaden an, indem viel Steuersubstrat verloren geht, das verteilt werden müsste mittels eines Finanzausgleichs, der den schwächsten Kantonen hilft, statt sie noch zusätzlich unter Druck zu setzen.
Auch die Arbeitnehmenden werden zueinander in Konkurrenz gesetzt, indem man die Verhandlungen über die Arbeitsverhältnisse individualisiert. Dies erreicht man durch Aushöhlung der Gesamtarbeitsverträge und Einführung von Konzepten wie dem Leistungslohn. Weil aber die Voraussetzungen dafür fehlen, die effektiven persönlichen Leistungen zu evaluieren, weil die Arbeitsprozesse immer verflochtener sind, hängt der Lohn mehr von der Verhandlungsfähigkeit als dem beruflichen Können des Einzelnen ab. Die Individualisierung der Verhandlungen stärkt zudem die Position der Arbeitgeber, vor allem, wenn die Arbeitslosenrate hoch ist. Vollbeschäftigung ist auch gar kein wirtschaftspolitisches Ziel mehr. Doch die Schuld wird den Arbeitslosen zugeschoben, indem man ihnen vorwirft, sie seien zu wenig mobil, ungenügend qualifiziert und fielen den Sozialversicherungen zur Last. Gegenüber den Topmanagern dagegen wird eine ganz andere Haltung gepflegt.
Wie meinen Sie das?
Im Hinblick auf die 1:12-Abstimmung nahm ich an einer Diskussion mit UBS-CEO Sergio Ermotti teil. Er behauptete, wenn er jährlich 8 Millionen Franken verdiene, sei dies gerechtfertigt, und wenn der CEO einer andern, konkurrierenden Bank 10 Millionen verdiene, müsse auch er soviel erhalten. Es gibt kein Kriterium, das solche Gehälter rechtfertigt, doch die Wirkung ist völlig anders.
Wie sind solche Riesengehälter möglich geworden?
Aus zwei Gründen: Der erste ist, dass die Entschädigungen der Manager heute öffentlich gemacht werden müssen, was zu einer Eskalation der Gehälter geführt hat. Der zweite Grund ist, dass man eine Verbindung herstellt zwischen den Managerlöhnen und den Gewinnen ihrer Unternehmungen sowie den Dividenden, die diese an ihre Aktionäre (Shareholder) auszahlen können. Dabei vernachlässigt man die andern Beteiligten (Stakeholder) inklusive Personal.
Sollte die Transparenz der Managerlöhne nicht mässigend auf diese wirken?
Das war tatsächlich so gedacht, funktioniert aber nicht, weil der grösste Teil der Aktionäre grosser Unternehmen Institutionen sind, die an kurzfristigem Profit interessiert sind. Die Finanzzahlen eines Unternehmens haben Priorität, das wird den Studierenden an den Wirtschaftsfakultäten und Business Schools eingeschärft. Dort wird auch gelehrt, dass der Börsenwert des Unternehmens zu maximieren sei, unabhängig von dessen langfristiger Ausrichtung, und dass die «Human Resources» wie Güter zu behandeln seien.
Hier hat es eine signifikante Veränderung gegeben: früher sprach man vom Personal, heute von den «menschlichen Ressourcen». Der Begriff impliziert, dass hier eine ständige Optimierung anzustreben sei, indem man aus den Mitarbeitenden möglichst viel herausholt und sie ersetzt, wenn sie krank oder zu alt sind. Dabei lässt man ausser Acht, dass die Mitarbeitenden zugleich auch Konsument/innen sind, die als solche die Wirtschaft stützen. Es ist eine Frage des Masses: Werden die unteren Lohnklassen zu schlecht bezahlt, benötigen sie letztlich staatliche Hilfe. Vorteilhafter wäre, sie besser zu entlöhnen, damit sie von ihrem Lohn leben können.
Sie sind sehr kritisch gegenüber dem System, wie es die Wirtschaftsfakultäten und -schulen lehren. Warum korrigieren diese ihre Lehre nicht?
Auch auf diese Frage gibt es zwei Antworten: Erstens ist die Überzeugung fest verankert, dass der Markt in jedem Fall besser ist als der Staat. Zweitens ist diese Lehre den persönlichen und beruflichen Interessen der Lehrenden förderlicher. Wenn man dieser dominierenden Denkrichtung folgt, ist es viel einfacher, eine akademische Karriere zu machen. Die Wirtschaftswissenschaft steckt in einer eigent-
lichen Krise. Forscher/innen, die vom Liberalismus abweichende Positionen vertreten, sind vor der Wirtschaftskrise noch toleriert worden, jetzt nicht mehr. Milton Friedman ist sehr geschickt gewesen, nicht nur bei der Vermittlung seiner neoliberalen Anschauung, sondern auch bei der Diskreditierung der «politischen Klasse» und der staatlichen Regelungen. Er hat das ganze Lehrsystem in den USA geprägt. Von dort haben wir neben seiner Ideologie auch dieses ganze System importiert, das sich in den Wirtschaftsfakultäten der westlichen Welt ständig reproduziert.
Gibt es daraus also keinen Ausweg?
Im Mai haben über 40 Organisationen von Studierenden in der ganzen Welt gemeinsam eindringlich wieder zu mehr Pluralismus in der Wirtschaftslehre aufgerufen. Ökonom/innen sind Wissenschafter/innen, für die es als solche möglich sein muss, Gegensätzen zwischen verschiedenen Paradigmen auf den Grund zu gehen, um die besten Lösungen für die Probleme der heutigen Zeit zu finden. Es ist sehr wichtig, dass es nebeneinander verschiedene Anschauungen gibt, um auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts passend antworten zu können. Wir sind aber bisher nur wenige, die über die Grundlagen der politischen Ökonomie und andere Sichtweisen eine kritische Debatte führen wollen, um wirklich aus den Schwierigkeiten herauszukommen, in denen unsere Gesellschaft heute steckt.
Wie könnte man diese Probleme lösen?
Wir müssen dem Staat wieder seine Rolle in der Wirtschaft und auch die dafür nötigen Mittel geben. Daher muss Schluss sein mit dem aktuellen Steuerdumping und mit der Angstmache, dass höhere Steuern nur die guten Steuerzahlenden abschrecken. Die Steuern sind nur ein Faktor, den man bei der Standortwahl anschaut. Ebenso entscheidend sind daneben die Lebensqualität, die Qualität der Dienstleistungen, Sicherheit und Stabilität sowie im Fall von Unternehmen die Qualifikationen und die Arbeitsamkeit der Arbeitskräfte.
Pietro Gianolli / Fi