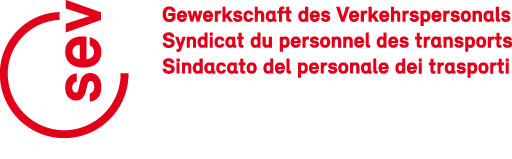Rückblick auf die Arbeitskämpfe der letzten Jahre: Streiken führt nicht immer zum Erfolg
«Streiken ist kein Tabu mehr»
Der Erfolg des SEV im Konflikt bei den Genfer Verkehrsbetrieben TPG rückt den Streik als gewerkschaftliches Aktionsmittel ins Rampenlicht. Wird dieses Instrument immer häufiger angewendet? Und was ist dabei der Schlüssel zum Erfolg? Dies wollte kontakt.sev vom Historiker Dominique Dirlewanger wissen.

Es gibt ein Vor und ein Nach dem 19. November in der Schweizer Gewerkschaftslandschaft», sagt der Historiker Dominique Dirlewanger. «Der Streik des TPG-Personals und sein Ausmass werden eine Sogwirkung haben.» Wir fragten den Waadtländer, wie sich die Streikanwendung in den letzten fünfzehn Jahren entwickelt hat.
Dominique Dirlewanger, in den letzten Jahren gab es in der Schweiz viele Streiks: z.B. 2006 bei Boillat/Swissmetall, 2008 im Industriewerk Bellinzona, 2012 bei Merck Serono, 2012/13 im Spital La Providence, 2013 bei Spar, 2013/14 bei Gate Gourmet und nun bei den Genfer Verkehrsbetrieben … Ist Streiken kein Tabu mehr?
Die betroffenen Angestellten betrachten den Streik als legitimes Instrument, auf der symbolischen Ebene. Das habe ich insbesondere bei den Streiks im öffentlichen Dienst des Kantons Waadt beobachtet. Streiken ist kein Tabu mehr, anders als in den 70er- und 80er-Jahren, als es noch unvorstellbar war. Das hat damit zu tun, dass sich die Konflikte an den Arbeitsplätzen verschärft haben, deshalb sind Streiks möglich geworden. Das heisst aber nicht, dass dies in den Medien so rüberkommt. Streiks werden oft heftig kritisiert, mit deplatzierten, übertriebenen Worten wie «Geiselnahme der Bevölkerung» oder «Atombombe» (Aussagen von Agefi-Chefredaktor François Schaller zum TPG-Streik in der Sendung «Infrarouge» des Westschweizer Fernsehens RTS vom 2. Dezember). Ohne die Statistik der Streikhäufigkeit in der Schweiz genau studiert zu haben, habe ich schon den Eindruck, dass es mehr Streiks gibt. Diese sind aber heute vor allem defensiver Natur …
Was meinen Sie damit?
Der letzte offensive Streik – also eine Mobilisierung, um etwas Neues zu erreichen, statt bisher Erreichtes zu verteidigen – war 2002 der Baustreik für die Frühpensionierung mit 60 Jahren. Im öffentlichen Dienst haben die defensiven Streiks wegen der Sparbudgets zugenommen. Diese Verhärtung hat auch mit dem Verschwinden des Beamtenstatus zu tun. Dieser wurde auf Bundesebene Anfang der 2000er-Jahre mit dem neuen Bundespersonalgesetz abgeschafft. Auch in vielen Kantonen haben haben deren Angestellte Errungenschaften wie Lohnautomatismen oder den Kündigungsschutz teilweise oder ganz verloren.
Vom öffentlichen Personal wird aber immer noch erwartet, dass es auf jede Kampfmassnahme verzichtet, als ob sein Status unverändert geblieben wäre …
Dennoch ist Streiken in der Privatwirtschaft immer noch viel riskanter als im öffentlichen Dienst, wo es trotz allem immer noch einen gewissen Schutz gibt. Dort ist Streiken kein Entlassungsgrund, anders als in Privatunternehmen, wie die Entlassungen von Streikenden bei Gate Gourmet und La Providence gezeigt haben. Das Streikrecht ist zwar seit dem Jahr 2000 in der Bundesverfassung verankert, aber nicht formell garantiert. So, wie auch nicht formell garantiert ist, dass die AHV- und Pensionskassenrenten das Existenzminimum wirklich sichern, obwohl die Verfassung dies eigentlich vorsähe. Auch wird paradoxerweise ständig der Anschein erweckt, die Macht liege in den Händen der Streikenden und die Arbeitgeber seien hilflos. Seit je wird versucht, die Gewerkschaften und die Streikenden zu kriminalisieren und sie vor Gericht zu zerren.
Sind also Einschränkungen des Streikrechts zu befürchten?
Ja und nein. Die Verankerung des Streikrechts in der Bundesverfassung war ein Sieg, der nicht unterschätzt werden darf. Im gesellschaftlichen Klima nach dem 2. Weltkrieg kritisierte die extreme Linke lautstark, die Arbeiterbewegung werde durch den Verzicht auf das Streikrecht im Rahmen
von Gesamtarbeitsverträgen geschwächt. Und die Rechte verteufelte Streiks als aus dem Ausland importiert – durch die Bolschewiken beim Generalstreik 1918 oder durch die Grenzgänger beim TPG-Streik 2014. So wird die Realität der Streikenden negiert, die nicht aus purer Herzenslust streiken.
Sie haben die Sparbudgets erwähnt. Sind die Management-Methoden auch sonst härter geworden?
Die Leitungen der Human Resources beziehen den Streik in ihre Strategie ein. Sie sehen die Auslösung eines Streiks in ihrem Verhandlungskalender vor und machen knapp vor dessen Beginn «Konzessionen», um den Eindruck zu erwecken, sie gäben wegen dem drohenden Streik nach. Dabei waren die «Konzessionen» im Verhandlungsplan vorgesehen. So lassen Manager sozusagen das Fegefeuer als das Paradies erscheinen …
Ein Streik lässt sich aber nicht nur als Reaktion auf harte Managementmethoden erklären. Für die Auslösung sind verschiedene, komplexe Elemente verantwortlich. Streiks findet man vor allem in Sektoren, wo Gewerkschaftsvertreter/innen vor Ort präsent und aktiv sind und aus der Mitte der Arbeitskollektive den Solidaritätsgedanken fördern und Vertrauen in die Gewerkschaft aufbauen.
Welche weiteren Elemente sind bei erfolgreichen Streiks zu beobachten?
Die Zahl der Beitritte, die die Gewerkschaften nach einem Streik erzielen, ist ein guter Gradmesser für die Präsenz der Gewerkschaftsvertreter/innen im Betrieb. Es braucht in der Schweiz vor allem noch
einen stärkeren verfassungsrechtlichen Schutz der Gewerkschaftsvertreter/innen und der Streikenden. Denn selbst wenn diese bei einer Entlassung deren Missbräuchlichkeit nachweisen können, werden sie höchstens mit sechs Monatslöhnen entschädigt.
Der Streik wird oft für das Mittel gehalten, mit dem bestimmt etwas erreicht werden kann. Das ist aber längst nicht immer der Fall …
Das haben etwa die Streiks im Spital La Providence und bei Gate Gourmet gezeigt (siehe separate Texte dazu weiter unten). Und die Streiks bei Boillat und Merck Serono wurden zu spät ausgelöst, auch wenn ihnen die Medien Legitimität zusprachen.
Der Streik bei den TPG ist ausserordentlich wichtig für den öffentlichen Dienst in Genf, denn es ist ein seltenes Beispiel eines präventiven Streiks mit dem Ziel, Verhandlungen zu ermöglichen. Bemerkenswert dabei war auch, dass nur der SEV zum Streik aufrief und dass sich die beiden andern Gewerkschaften nach dem Beginn des Streiks diesem ebenfalls anschlossen. Letztlich lag die Teilnahme bei 100 %, trotz allem, was über das angebliche «psychologische Mobbing» gesagt wurde. Doch es läuft nie genau so ab. Es wird im-mer gezögert. Arbeitnehmende fürchten sich zu streiken, auch wenn sie spontan gerne mitmachen würden.
Für Arbeitssoziolog/innen, die sich an der Theorie der rationalen Entscheidung (rational choice theory) orientieren, sind Streiks ein Rätsel. Denn diese Theorie geht davon aus, dass jeder Akteur den maximalen Nutzen sucht. Da man bei einem Streik besser fährt, wenn man nicht mitmacht, weil man so keine Sanktionen wie Lohnabzüge riskiert und von einem Streikerfolg dennoch profitiert, sollte rein rational betrachtet eigentlich niemand streiken wollen. Und doch sind viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Kämpfen bereit!
Vivian Bologna / Fi
SEV-Streiks: letztes Mittel, wenn keine Verhandlungen möglich sind
Nach Jahrzehnten fast vollständigen Arbeitsfriedens hat der SEV in den letzten zwölf Jahren gleich vier Streiks erlebt: 2002 bei den Genfer Verkehrsbetrieben, 2005 bei der Luganersee-Schifffahrt, 2008 im Industriewerk Bellinzona (mit Unia, eigentlich ein Fabrikstreik) und nun erneut bei den TPG.
Zumindest bei den letzten drei Streiks stellt man bei genauerer Betrachtung zwei gemeinsame Ursachen fest: einen gewissen Budgetrigorismus der öffentlichen Hand, der die Mittel für die öV-Unternehmen schwinden lässt, und die übereilte, unbedachte Reaktion der Direktionen, wegen der Mittelkürzungen sogleich Leistungen und Arbeitsplätze abzubauen.
In den letzten Jahren haben im Service public neue Formen der Finanzierung Einzug gehalten, basierend auf Leistungsvereinbarungen, welche die politischen Behörden den öV-Unternehmen mehr zuteilen als mit ihnen aushandeln. Von letzteren wird immer mehr verlangt, ohne dass die Abgeltungen entsprechend steigen, sondern diese bleiben im besten Fall konstant. Eigentlich wäre es an den öV-Unternehmen, sich gegen schlechtere Bedingungen zu wehren. Doch weil sie zu den Behörden vielmals in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, dem sie kaum entrinnen können (weil sie diesen z.B. auch gehören), begnügen sie sich eben oft einfach damit, die Budgetkürzungen auf ihr Personal abzuwälzen.
Unter solchen Bedingungen wird es für das Personal und seine Vertreter natürlich unmöglich, mit den Direktionen eigentliche Verhandlungen zu führen, da diese nicht über die nötigen Kompetenzen verfügen. Somit verwundert es nicht, dass der Rückgriff auf Kampfmassnahmen, der eine Zeit lang fast unverstellbar war, immer häufiger vorkommt. Dies, weil das Personal nur so aus dem aufgezeigten Mechanismus ausbrechen und auf die politischen Behörden, von denen der Druck ausgeht, Gegendruck ausüben kann.
Bei den drei Streiks fiel auch auf, dass sie in der öffentlichen Meinung und sogar bei der öV-Kundschaft recht viel Verständnis und Unterstützung fanden, obwohl wir in unsern Breitengraden eher nicht an solche Streiks gewohnt sind. In Bellinzona wurde die Solidarisierung noch dadurch gefördert, dass der «Feind» von der andern Seite des Gotthards kam. Daher war es relativ einfach, die ganze Region dazu zu bringen, gegen die SBB Front zu machen.

Die Sympathien für die Streikenden zeugen aber auch von wachsendem Unbehagen gegenüber einer gewissen politischen und gesellschaftlichen Tendenz, das Finanzergebnis ins Zentrum aller Überlegungen zu stellen. Wenn die Bevölkerung auf solche Streiks positiv reagiert, obwohl ihr diese Unannehmlichkeiten bescheren, dann sicher deshalb, weil sie sich bewusst ist, dass guter Service public seinen Preis hat.
Gewisse Politiker/innen vergessen dies gerne. Darum muss sie der SEV immer wieder daran erinnern, wenn nötig auch mit einem Streik.
Pietro Gianolli / Fi

Industriestreiks finden in der Bevölkerung Rückhalt
Die Streiks bei Boillat, Merck Serono oder Novartis zeigen, dass sich die Unia oft gegen die Schliessung von Standorten grosser internationaler Konzerne wehrt. Pierluigi Fedele, Sektorleiter Industrie in der Unia-Geschäftsleitung, analysiert die Unia-Streiks der letzten Jahre.
Immer wieder kämpft die Unia für den Erhalt von Arbeitsplätzen und erreicht «nur» einen Sozialplan mit Abgangsentschädigungen. Die Entscheide von Konzernen mit Sitz im Ausland sind nicht einfach zu beeinflussen, geschweige denn rückgängig zu machen. «Man müsste auf europäischer Ebene mobilisieren, doch das ist nicht einfach. Zurzeit gelingt es noch nicht, Mitarbeitende an Standorten in verschiedenen Ländern dazu zu motivieren, gemeinsam zu kämpfen.»
«La Boillat»
Der Kampf gegen die Schliessung der Swissmetal-Fabrik Boillat in Reconvilier im Jahr 2006 führte nicht zum Ziel. «Nach neun Streiktagen waren einige Resultate erreicht. Der zweite Streik, der 30 Tage dauerte, war zu lang, der Bewegung ging der Schnauf aus», erzählt Pierluigi Fedele.
«Die Angestellten waren gespalten: ein Drittel war hoch motiviert, ein Drittel jederzeit zum Streikabbruch bereit und ein Drittel völlig gegen den Streik.» Die Unia lässt die Mitarbeitenden natürlich immer abstimmen, ob sie streiken wollen. Auch wenn einem Streik theoretisch 50 % der Angestellten + 1 zustimmen müssen, verlangt die Unia für den Beginn eines Streiks eher 75 % an überzeugten Mitarbeitenden, «denn sonst bröckelt die Bewegung schnell ab».
Pierluigi Fedele unterstreicht auch, dass die Unia natürlich nicht bei jedem Konflikt gleich einen Streik vom Zaun bricht: «Wir gehen stufenweise vor und versuchen zuerst mal zu verhandeln, verteilen Flugblätter, organisieren eine Kundgebung und dann einen Arbeitsunterbruch. Wir streiken nie zum Spass. Ein Streik ist die ultima ratio, das letzte Mittel.»
Eine Wende?
«Der Streik bei Serono 2012 war in vielerlei Hinsicht exem-plarisch», erzählt der Gewerkschafter weiter. «Es machten hoch qualifizierte Leute mit und es wurde mit innovativen Mitteln mobilisiert: Flash Mobs, originellen Animationen und über die sozialen Medien.»
Der Streik bei Novartis 2011 war ebenfalls exemplarisch, weil Labor- und Büroangestellte Seite an Seite kämpften. Letztlich leisteten Personal und Kanton Waadt ihren Beitrag, um den Standort zu retten. Doch kaum zwei Jahre später wurde dieser von Novartis einer neuen Gruppe überlassen, die nicht vollständig in ihrem Besitz ist. Somit gilt es auf
der Hut zu sein, Gewerkschafter/innen können sich nie auf ihren Lorbeeren ausruhen …
«Dieses Jahr bei Pavatex war die Situation anders, denn die Direktion war weniger rigide, die Streikenden haben einige gute Resultate erzielt», freut sich Pierluigi Fedele. «Wenigstens beginnen auch die Schweizer langsam zu begreifen, dass Streiken ein gutes Mittel ist, um etwas Konkretes zu erkämpfen.»
Was ist der Hauptunterschied zwischen SEV, VPOD und Unia? Letztere hat es mit privaten Akteuren mit privaten Interessen zu tun. Und natürlich ist es für Fabrikangestellte einfacher, in der Bevölkerung Unterstützung zu finden, wenn sie streiken …
Henriette Schaffter / Fi

GAV-Kündigungen nicht kampflos geschluckt
Bei den VPOD-Streiks im Spital La Providence und bei Gate Gourmet legte nur eine Minderheit die Arbeit nieder, denn die Furcht vor Entlassungen war gross. Und die Regierung half mehr dem Arbeitgeber.
m April 2012 wurde bekannt, dass sich die Privatspital-Gruppe Genolier Swiss Medical Network für die Übernahme des privaten, aber subventionierten Spitals La Providence in Neuenburg interessierte. Weil dieses mit dem Verlust öffentlicher Leistungsaufträge rechnete, sah es die Übernahme als Chance. Dafür stellte Genolier aber die Bedingung, dass das Spital den kantonalen Gesamtarbeitsvertrag «Santé 21» für subventionierte Spitäler kündigt – was dieses tat, obwohl es vom Kanton weiterhin Abgeltungen erhalten sollte. Genolier wollte die Wochenarbeitszeit erhöhen, die Zulagen für Pikett-, Nacht- und Sonntagsarbeit senken, ein neues Lohnsystem einführen und zudem die Reinigung und Restauration auslagern.
Dagegen organisierten VPOD und Syna am 18. September 2012 einen Warnstreik und Proteste, bei denen über 100 der rund 350 Mitarbeitenden mitmachten. Die Spitalleitung aber teilte am 21. November mit, 84 % der Mitarbeitenden hätten an einer Umfrage teilgenommen und 76 % davon die Genolier-Übernahme befürwortet. Am 26. November traten rund 30 Mitarbeitende in einen unbefristeten Streik. Am 5. Dezember nahm das Kantonsparlament eine Motion an, die die Einhaltung des GAV forderte. Es gab auch mehrere Demos mit Hunderten von Teilnehmenden. Dennoch tolerierte die Regierung die GAV-Kündigung sowie am 4. Februar 2013 die Entlassung der 22 verbliebenen Streikenden, die der VPOD bei der Internationalen Arbeitsorganisation als missbräuchlich einklagte. Am 15. Februar bestätigte Genolier die Übernahme definitiv und führte die schlechteren Anstellungsbedingungen per 1. März 2014 ein.
GAV-Kündigung auch in Genf
Im Juni 2013 kündigte die Gate Gourmet Switzerland AG, die am Flughafen Genf damals etwa 70 % der Flugzeug-Bordverpflegungen lieferte, den GAV, den sie 1997 mit dem VPOD abgeschlossen hatte. Hintergrund: Seit Anfang Jahr war der (schlechtere) GAV für die Gastrobranche auch auf Cateringfirmen anwendbar. Mitte September verletzte Gate Gourmet zudem die Friedenspflicht mit einer Massenentlassung: Von 122 Festangestellten nach GAV erhielten 86 die Kündigung und Einzelarbeitsverträge zum Unterschreiben. Diese enthielten Lohnkürzungen von 11 bis 637 Franken monatlich auf Löhnen zwischen 3553 und 6107 Franken sowie weitere Verschlechterungen bei Zulagen, Lohnsystem und Pensionskasse.
Der von einer Generalversammlung beschlossene Streik begann am 14. September. Doch Gate Gourmet konnte weiter Mahlzeiten ausliefern dank Temporärpersonal, Kadern und weil nicht alle Mitarbeitenden streikten (z. B. am 16. September die Hälfte von 40 Aktiven). Ende Oktober waren es noch rund zehn Streikende, von denen sechs nach einer Protestaktion die Kündigung erhalten hatten wegen angeblichem Hausfriedensbruch.
Erst am 31. Mai 2014 und unter Vermittlung der Genfer Regierung einigte sich Gate Gourmet mit der Zentrale des VPOD auf vertrauliche Entlassungsbedingungen für sieben Streikende (denen der VPOD mit der Streichung des Streikgelds drohte) sowie auf die Anwendung der bei der Vermittlung auferlegten Arbeitsbedingungen bis Ende 2015 und auf die Aushandlung eines GAV für Airline-Caterer in Genf. Der VPOD-Regionalsekretär kündigte unter Protest.
Markus Fischer